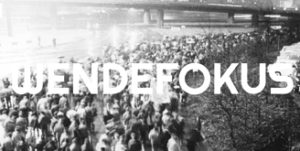03.07. – 28.08.2023
Mo, 03.07.2023
Ralph Placke war zur „Wende“ 28 Jahre alt und leitete den Studentenclub an der Pädagogischen Hochschule in Halle/Köthen und war damit staatlich Angestellter. Placke beschreibt die Möglichkeiten und Restriktionen beim Betrieb eines solchen Ortes. Die sich auflösenden und dann erst wieder entstehenden Strukturen ergaben für Placke (der die Hoffnung auf eine reformierte DDR, einen „Sozialismus mit demokratischen, menschlichen Antlitz“ hatte) und in seiner Umgebung Freiheiten und Bewegungen: So wurde das einstige FDJ-Mitglied im Studierendenrat aktiv und erlebte so aus nächster Nähe die Umstrukturierungen und Abwicklungen an der Universität mit.Hier mehr Wendefokus
Mo, 10.07.2023
Christoph Rackwitz hatte eine „luxuriöse“ Ausbildung an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, an der er 1982 sein Diplom ablegte und bis 1987 als Lehrbeauftragter tätig war („es gab ständig Ärger„). Rackwitz war zeitweise CDU-Mitglied und suchte sich ein Atelier auf dem Dorf. Am 3.10.1989 lehnte der Grafiker die „Ehrenmedaille 40 Jahre DDR” ab und versuchte stattdessen bei der Verleihung, den Aufruf des Neuen Forum zu verlesen. Rackwitz bezeichnet die Zeit um 1989, „in der man erst mal Panik“ bekommen hat, als „Umbruch„.. Hier mehr Wendefokus
Mo, 17.07.2023
Winfried Radziejewski durfte nicht (als Bekannter Wolf Biermanns) als Musikwissenschaftler arbeiten, hatte Berufsverbot, und war im Jahr 1988 schwer erkrankt, weswegen ihm auch Reisen (auch aus therapeutischen Gründen) in die Nähe von Stuttgart, West-Berlin und Holland genehmigt wurden. „Offenheit, Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet„, bekam es Radziejewski früh mit der Staatssicherheit zu tun. Er organisierte monatliche philosophische Diskussionsveranstaltungen in den Räumen eines bekannten halleschen Malers, empfand die Ausreisewilligen aus der „gelähmten DDR“ als „Egoisten„, sah die Aktivitäten der Kirche ebenfalls kritisch, saß 1989 am Runden Tisch unter dem Namen die „Aktion die Drei“ und erschrak vor dem dort einkehrenden „konservativ-autoritären“ Geist. Radziejewski nennt die Ereignisse eine „Restauration, die Fakten und Farben ignorieren konnte.“ Hier mehr Wendefokus
Mo, 24.07.2023
Dore Richter durfte – nach mehreren Verhören der Stasi – seit 1983 keiner Arbeit nachgehen, weil ihr antistaatliche politische Aktivitäten unterstellt wurden. Richter wurde „unauffällig großgezogen„, später politisiert durch ihre Schwester und deren Freunde, die bei ihr die „Sehnsucht“ nach „guten Büchern“ und Musik weckte, während sie sich eher zurück hielt; aus „Angst um meine Tochter„. Mit den Einschüchterungen der Stasi, dem Misstrauen und Druck, versuchte Richter offensiv umzugehen. Nachdem die besten Freundinnen 1983 ausgereist sind, zog Richter ihren eigenen Ausreiseantrag 1985 zurück. Dennoch: „Ich hatte nie gedacht, dass sich was ändert„, was der frühen Beteiligung an den Montagsdemonstrationen – mit dem Ziel einer „Wiedervereinigung“ keinen Abbruch tat. Hier mehr Wendefokus
Mo, 31.07.2023
Der heutige stellvertretende Leiter des Departments Stadt- und Umweltsoziologie am Helmholtz-Zentrum in Leipzig, wohnte schwarz in verfallenen Häusern, während er zur Geschichte der frühen Sowjetunion promovierte. Rink studierte Philosophie, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft an der Karl-Marx-Universität Leipzig und empfand das Gefühl der „Stagnation“ als bestimmend in den 80er Jahren. Trotzdem – oder gerade deswegen – unternahm er den Versuch Freiräume zu erhalten und das System mit Hilfe der erschaffenen Gegenkultur zu unterwandern. Rink nahm an der „entscheidenden“ Demonstration am 9. Oktober in Leipzig teil und war später von den „empörenden Abwicklungen“ der Universität betroffen. Heute seien „nur noch Rudimente des Herbst 89“ vorhanden. Rink erkennt – nach leninistischer Lesart – die Ereignisse als Revolution an; „Die Unterdrückten wollen, die Herrschenden können nicht so weiter machen„. Die grundlegenden Verhältnisse, die Produktions- und Eigentumsverhältnisse, seien verändert worden.Hier mehr Wendefokus
Mo, 07.08.2023
Lothar Rochau wurde als evangelischer Diakon in eine „fast atheistische Stadt“ (Halle-Neustadt) berufen. Dort sammelte sich um Rochau schnell ein junges, intellektuelles Umfeld, welches offene Diskussionen (unter anderem wurden Bücher von Erich Fromm und George Orwell gelesen) führte und so schnell ins Blickfeld der Staatsmacht kam. Auch der Kirche waren die alternativen Lebensentwürfe für einen anderen, besseren Sozialismus „mit menschlichen Antlitz“ ohne autoritäre Vorschriften zunehmend suspekt. Rochau selbst wurde kriminalisiert, vor dem obersten Gericht der DDR angeklagt, verurteilt, ins Zuchthaus verfrachtet und 1983 gegen seinen Willen aus der DDR abgeschoben: „Mir war zum heulen, ich fühlte mich beschissen.“ Rochau musste in die BRD, wo er weiter aktiv war, um zum schnellstmöglichen Zeitpunkt wieder in die sich auflösende DDR („Eine Sternstunde der Menschheit„) zurückzukehren. Denn: „Man konnte nicht alles der CDU überlassen„. Hier mehr Wendefokus
Mo, 14.08.2023
Roman Ronneberg war 1989 17 Jahre alt und spielte in der Punkband „Abraum„, die sich in Wolfen (Sachsen-Anhalt) formierte. Der heutige Diplompädagoge Ronneberg beschreibt die zaghafte Entwicklung einer Opposition in Wolfen, seine unkonkreten Vorstellungen eines anderen DDR-Sozialismus und die Attraktivität einer sich in Halle entwickelnden Politszene, die sich Freiräume zu nehmen begann und sich – gerade nach der sogenannten Wende- in verstärkter Auseinandersetzungen mit der nationalistischen Grundstimmung befand.Hier mehr Wendefokus
Mo, 21.08.2023
Friedemann Rösel arbeitete, als studierter Ingenieur, ab 1972 in Leuna und wohnte in Halle-Neustadt. Bereits im zweiten Lehrjahr gab es erste Konfrontationen mit den Parteioberen. Rösel begreift sich selbst – auch heute – als Marxist in Opposition, der bereits früh die DDR kritisierte: Rösel „war für den Marxismus„, aber gegen die SED-Politbürokratie: Die DDR sei ein „vom Kapitalismus befreiter Staatsmonopolismus“ gewesen.
Rösel war philosophisch interessiert und agierte in einem Literaturzirkel, der sich auch – mehr oder wenig offen – kritisch mit den bestehenden Verhältnissen auseinander setzte. Zusammen mit Lothar Rochau (und drei weiteren Personen, wovon einer IM der Staatssicherheit war), stellte Rösel die DDR Realität offen in Frage und betrieb politische Studien zu alternativen Sozialismuskonzepten. Es ging der Gruppe darum „freie Kommunikationsrunden“ einzurichten. 1981 wurde Rösel, der sich an den Schriften Rudolf Bahros orientierte und abarbeitete, verhaftet und zu 2 1/2 Jahren Haft verurteilt. Rösel beschreibt seine Erfahrungen: im Widerstand, um den politischen Prozess gegen die Gruppe, das Verweigern einer offenen Auseinandersetzung in der DDR, Rösels heutiges Festhalten an der marxistischen Theorie, sowie die Aktivitäten und Deutungen der Ereignisse um das Jahr 1989.Hier mehr Wendefokus
Mo, 28.08.2023
Uwe Larsen Röver arbeitete um das Jahr 1989 in der Verwaltung eines Naturschutzinstituts, wodurch er Einblicke in die verheerenden Umweltzustände der DDR gewinnen konnte. Larsen Röver war eine knappe Dekade in der SED organisiert. Die immer häufiger werdenden offensichtlichen Widersprüche zwischen Realität und Anspruch des real existierenden Sozialismus, ließen allmählich ein kritisches Bewusstsein entstehen. Als Folge dessen beteiligte sich Larsen Röver am Runden Tisch für die Vereinigte Linke und begann Kongresse für die sich formierenden Betriebsräte zu organisieren. Larsen Röver nennt die Ereignisse einen „friedlich demokratischen Prozess„, der nicht zu den gesellschaftlichen Verhältnissen führte, die er sich erhofft hatte. Es war ein „Versuch einer demokratischen Revolution, der durch die Schnelligkeit der Ereignisse gescheitert“ sei. Hier mehr Wendefokus